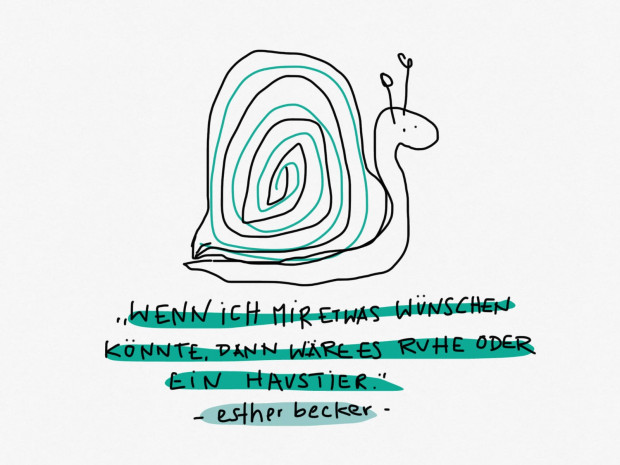
18. Mai 2021 •
Lesen eröffnet Welten, schafft Bilder und Zugänge zur eigenen Fantasie – und als ich „Das Leben ist ein Wunschkonzert“ zu lesen beginne, hatte ich ganz andere Erwartungen an die Bilder, die es hervorrufen würde. Rollen: Schnecke 1, 2, 3, 4. Die Hauptrolle: Anna, ein junges Mädchen. Ihre Freundin Hannah. Zwei Schülerinnen von nebenan? Dann noch der Pizzajunge, eine Professorin, eine Lehrkraft. So weit, so offensichtlich – aber hat Anna keine Eltern? Naja, denke ich und beginne zu lesen. Die Schnecken treten im Schneckenchor auf. Sie vermissen ihre vierte Schnecke, sprechen über die Menschen, aber worauf sie hinauswollen, weiß ich nicht. „Das Leben ist kein Wunschkonzert“, schließt ihr Sprechchor. Ein Satz, den Anna bei ihrem ersten Auftritt direkt wieder aufnimmt. Hieß das Stück nicht „Das Leben ist ein Wunschkonzert?“, wundere ich mich. Anna reflektiert über das Kind-Sein, darüber, dass Erwachsene immer behaupten, dass das Leben eben kein Wunschkonzert sei, und ich bin gerührt, wie detailgenau dieses Mädchen auf die Welt schaut. Wie oft hören wir diesen Satz? Das Leben ist kein Wunschkonzert, kein Ponyhof! Streng dich an! Nimm dich zusammen! Haben wir nicht auch all diese Glaubenssätze als Kind gelernt?
Annas Welt ist alles andere als ein Wunschkonzert. Ihre Eltern sind alkoholkrank. Die Sucht ihrer Eltern führt dazu, dass Anna für sich selbst und für ihre Eltern verantwortlich ist. Diesen Prozess nennt man Parentifizierung. Obwohl sie als Kind schutzbedürftig ist, kümmert sie sich um Haushalt und Essen. Doch das ist keine leichte Aufgabe. „Ich wünsche mir einen Pizzaladen in meinem Zimmer! Jeden Tag vier Jahreszeiten!“, sagt Anna. Wir erleben das gesamte Stück aus ihrer kindlichen und doch so erwachsenen Perspektive.
Keine klassischen Stereotype
Langsam offenbaren sich die kleinen Parallelitäten, die Becker in den Sprechchoreinsätzen der Schnecken und Annas Text versteckt hat. Zu Beginn erzählen die Schnecken von ihrer Vorliebe für Bier, später Anna von den Momenten, in denen Erwachsene Bier trinken. Immer weiter verweben sich die Textpassagen der Schnecken und Annas Perspektive auf die Erwachsenenwelt. Dabei verkörpern die Schnecken eine kindliche Sicht auf die Dinge: fantasievoll, spielerisch. Annas kindliche Bedürfnisse nach Zuneigung, danach umsorgt zu sein und spielen zu dürfen, stehen ihren scharfen, analytischen Gedankengängen gegenüber. Und eben diese Kombination löst bei mir den Wunsch aus, sie in Schutz zu nehmen. Mich überkommt Mitleid und dennoch bewundere ich, wie erwachsen ein junger Mensch sein kann. Annas Eltern treten als Figuren nie auf, sind lediglich Schatten ihrer Erzählung. Sie sind im Stück wie in Annas Leben insbesondere eins: abwesend. Sie hört sie nur, wenn sie betrunken in der Küche herumschreien: „Wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann wäre das Ruhe oder ein Haustier. Es muss kein großes sein. Hauptsache, ich bin nicht allein, wenn es laut wird in der Küche.“ Sätze wie diese treffen in einer unvermittelten Direktheit, mit der Becker ohne viel Dramatisierung Annas Lebenssituation nahbar macht.
Laut Bundesministerium für Gesundheit (Stand: 2016) leben 2,65 Millionen Kinder mit einem alkoholabhängigen Elternteil. Bei Anna betrifft die Erkrankung sogar beide Elternteile und sie holt sich Hilfe bei der Nachbarin. Wie andere psychische Erkrankungen können Sucht und Drogenmissbrauch das Risiko der Kinder, ebenfalls psychisch zu erkranken, deutlich erhöhen. Wenn ich Beckers Stück vor dem Hintergrund dieser Daten betrachte, erschrecke ich fast vor der Abgeklärtheit, mit der Anna ihre Geschichte erzählt: Sie sucht pragmatische Lösungen, um sich zu helfen und die Erkrankung ihrer Eltern zu verstecken. Auf die Frage, warum ihre Eltern sie nicht zur Schule fahren können, behauptet Anna, dass sie krank seien. Gefühle, wie Scham und Hilfslosigkeit schweben wie eine Gewitterwolke über Annas Geschichte, obwohl sie nie ausgesprochen werden. Das Stück zeigt emotionale Vernachlässigung und kommt dabei ohne Gewaltdarstellungen aus. Und es ist bemerkenswert, dass Becker keine klassischen Stereotype bedient: Über das soziokulturelle Umfeld von Anna erfahren wir, dass ihre Familie neben einer Professorin wohnt, in einem eigenen Haus. Und: Wir erleben Annas Emotionen, ohne, dass ihre Eltern zum personifizierten Schlechten werden. Denn „sie sind krank“ – sie haben zwar keine Grippe, aber sie brauchen Hilfe. Und die steht ihnen zu, so wie es allen psychisch Erkrankten zustehen sollte. Und so wie Anna ihre Kindheit zusteht.


